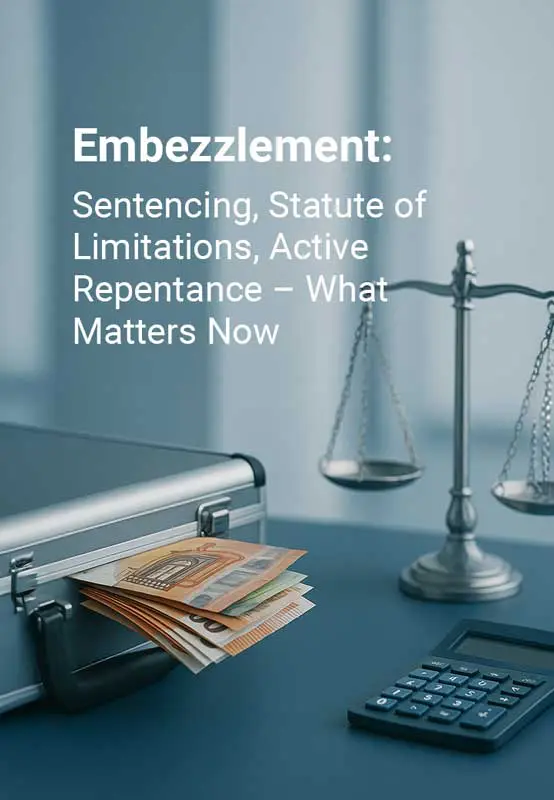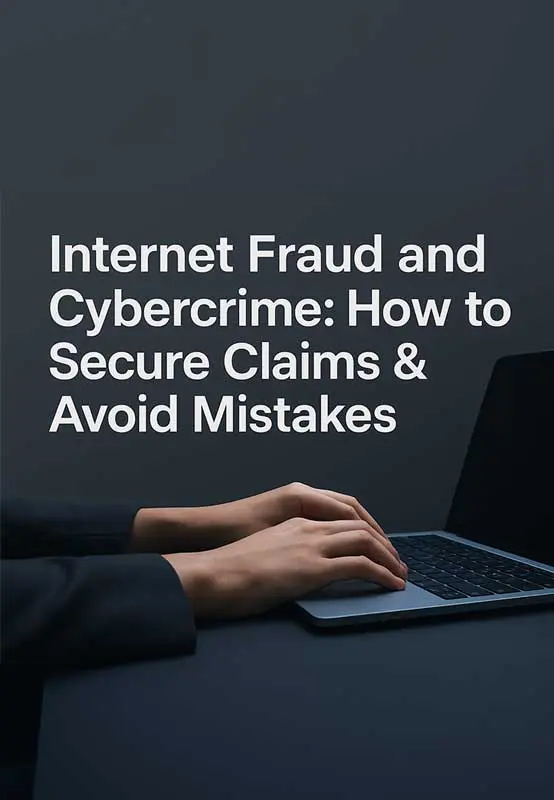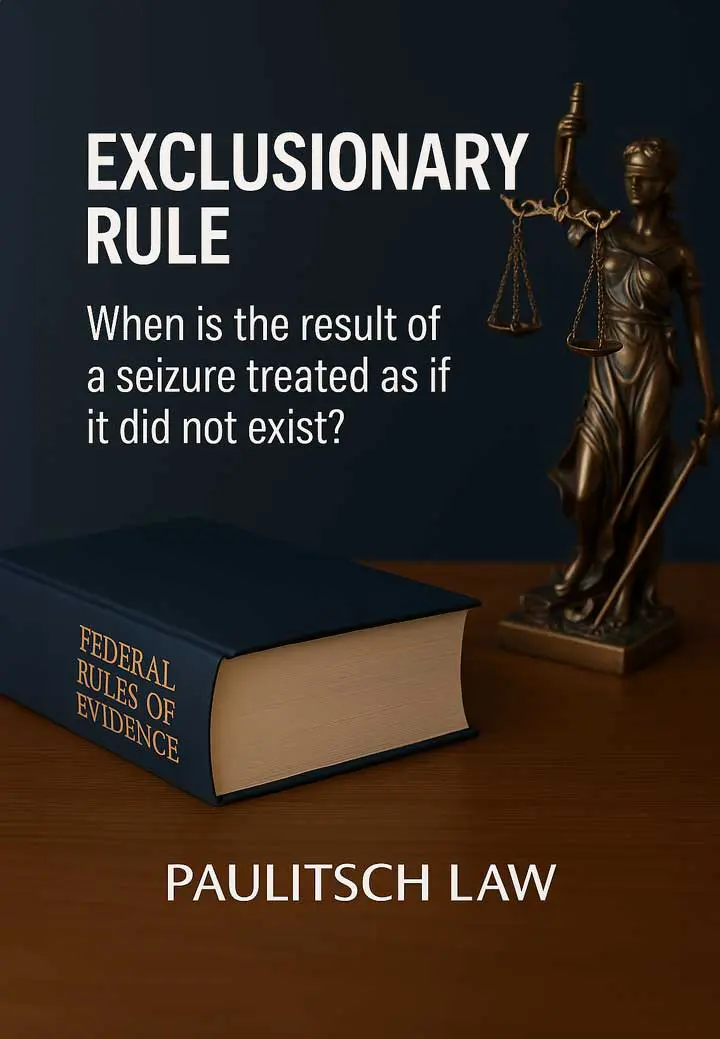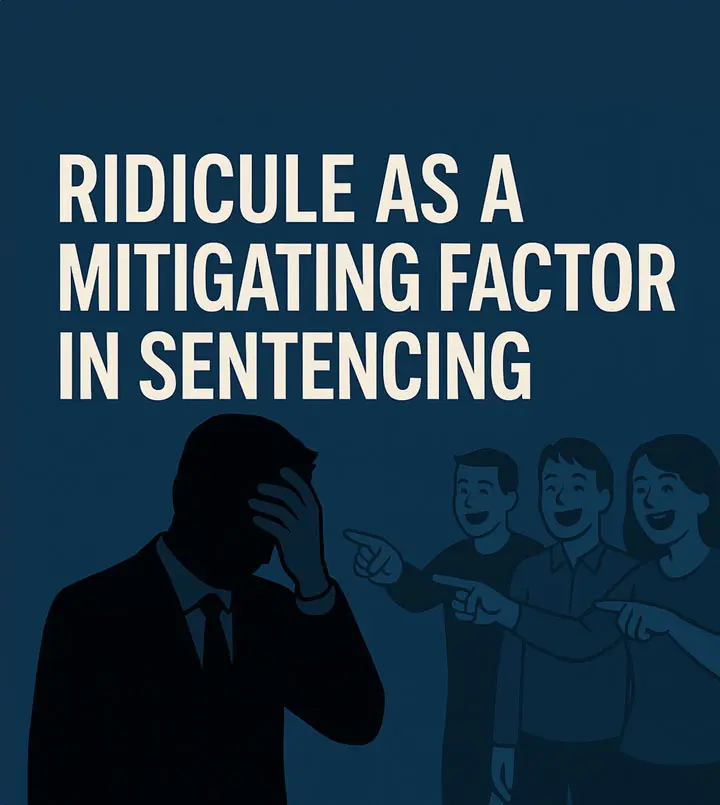Es wurde schon lange kritisiert, dass die Normen in der österreichischen Strafprozessordnung zur Sicherstellung von Gegenständen nicht für Datenträger (IT-Endgeräte) und Daten geeignet sind. Das Smartphone spiegelt im Grunde das Leben seines Benutzers wieder und greift damit tief in Grundrechte ein. Aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs musste die Sicherstellung und Beschlagnahme von IT-Endgeräten und Daten neu geregelt werden. Die neuen Bestimmungen sind nun am 1. 1. 2025 in Kraft getreten.
An den materiellen Voraussetzungen hat sich im Wesentlichen kaum etwas geändert. Die Beschlagnahme von Datenträgern und Daten ist (niederschwellig) zulässig, wenn sie aus Beweisgründen erforderlich scheint und aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass dadurch Informationen ermittelt werden können, die für die Aufklärung einer Straftat wesentlich sind. Es wurden weder erhöhte Voraussetzungen an den Anfangsverdacht festgelegt noch eine Einschränkung auf bestimmte Delikte vorgenommen.
Allerdings erfordert die Beschlagnahme von Datenträgern und Daten nun eine gerichtliche Bewilligung mit erhöhter Begründungspflicht. Einerseits müssen die Datenkategorien und die Dateninhalte, die zu beschlagnahmen sind, umschrieben werden. Unter Datenkategorien sind allgemeine Festlegungen wie zB Kommunikationsdaten, Standortdaten, Fotos etc zu verstehen. Dateninhalte beziehen sich im Gegensatz dazu auf den Ermittlungszweck und das gesuchte Beweismaterial. Andererseits muss auch ausreichend klar hervorgehen, in Bezug auf welchen Zeitraum die Beschlagnahme zu erfolgen hat. Damit soll vermieden werden, dass Strafverfolgungsbehörden den gesamten Datenbestand durchsehen dürfen.
Nach erfolgter Beschlagnahme sind die Daten von der Ermittlungsbehörde technisch aufzubereiten. Anschließend erfolgt die inhaltliche Auswertung, wobei die StA nur die Ergebnisse der Auswertung zum Akt nehmen darf, die für das Verfahren von Bedeutung sind und als Beweismittel verwendet werden dürfen. Sowohl Beschuldigte als auch Opfer haben das Recht, das Ergebnis der Datenaufbereitung einzusehen und die Auswertung von Daten anhand weiterer Suchparameter zu beantragen. Der Beschuldigte kann zudem einen Antrag stellen, weitere relevante Ergebnisse der Auswertung zum Akt zu nehmen bzw nicht relevante Daten zu vernichten.
Ergeben sich bei Auswertung der Daten Hinweise auf die Begehung einer anderen strafbaren Handlung (sog Zufallsfund), hat die StA einen gesonderten Akt anzulegen, soweit die Verwendung als Beweismittel zulässig ist.
Dem Rechtsschutzbeauftragten obliegt ein umfangreiches Informations-, Prüfungs- und Kontrollrecht der Anordnung, Bewilligung und Durchführung der Beschlagnahme von Datenträgern und Daten.
Details zu dieser Neuregelung im aktuellen Artikel der Ecolex von den Kollegen Rechtsanwaltskammerpräsident Michael Rohregger und Leo Matthias Seidl, die die komplexen neuen Bestimmungen verständlich zusammengefasst haben.