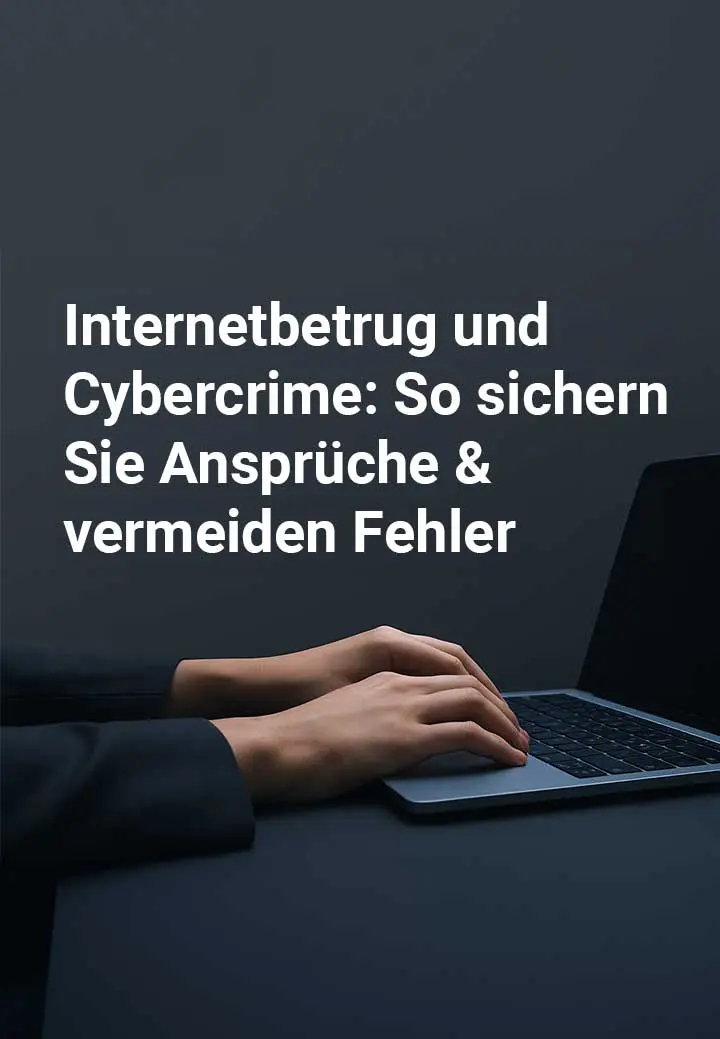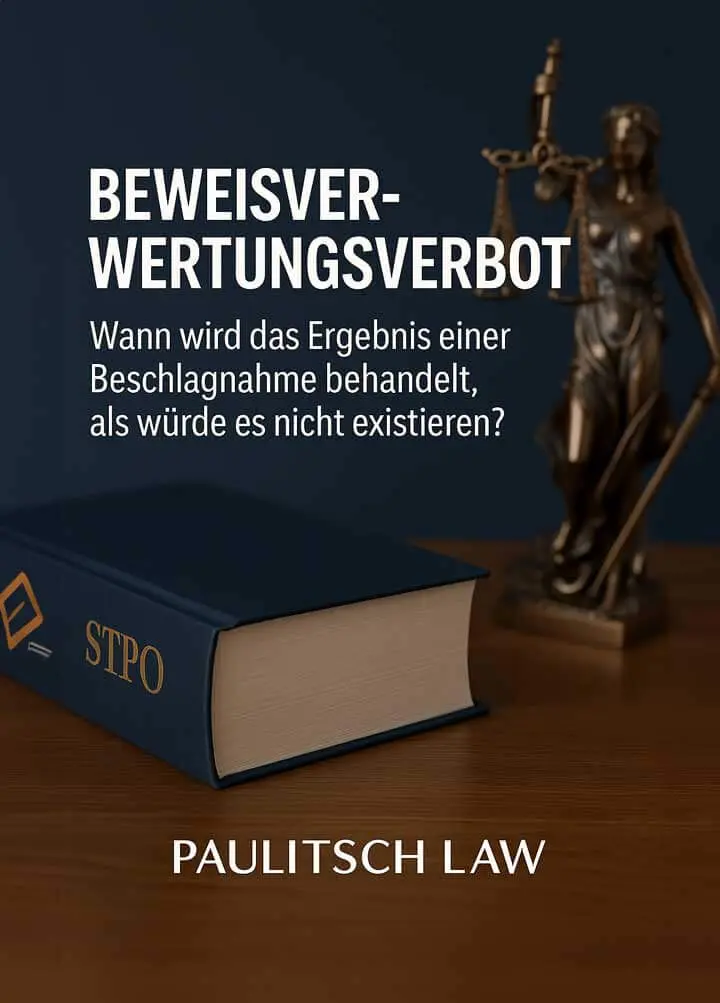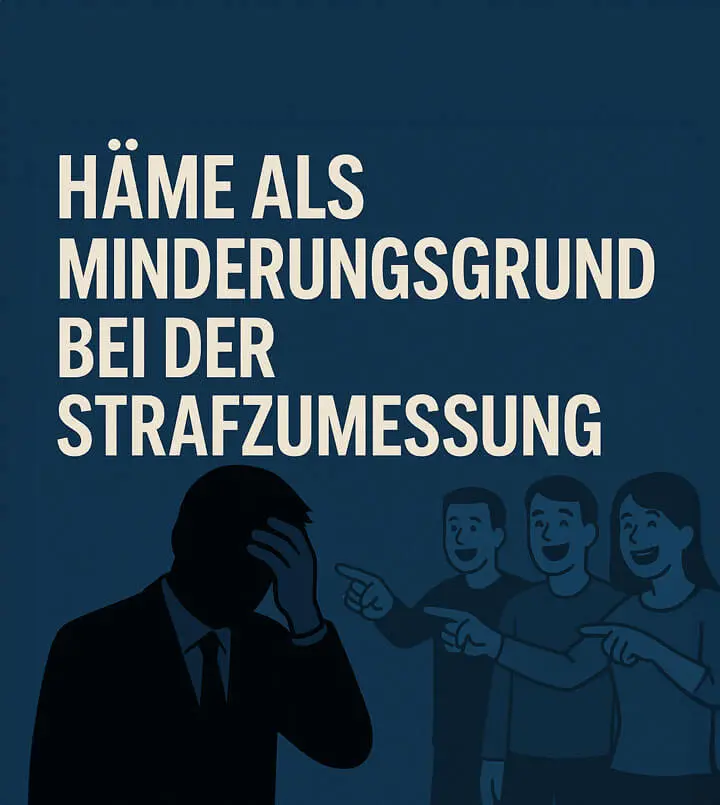Veruntreuung (§ 133 Strafgesetzbuch, StGB AT) ist als Vermögensdelikt eines der zentralen Delikte im Wirtschaftsstrafrecht. Man versteht darunter die unrechtmäßige Zueignung eines anvertrauten Gutes. Unter einem „Gut“ wird nicht bloß eine körperliche Sache, sondern auch eine unkörperliche, wie beispielsweise Guthaben auf einem Bankkonto, verstanden. Es kann daher nicht nur ein Teil aus dem Lager eines Unternehmens veruntreut werden, sondern auch Guthaben auf einem Bankkonto.
Umgangssprachlich wird für Veruntreuung oftmals auch der Begriff „Unterschlagung“ verwendet. Die beiden Delikte sind zu trennen, auch wenn sie Ähnlichkeiten aufweisen. Bei der Veruntreuung wurde dem Täter das Gut zunächst im guten Glauben anvertraut. Bei der Unterschlagung hat der Täter das Gut auf sonstige Weise erlangt.
Unterschied Veruntreuung vs. Untreue
Verwechslungsgefahr besteht auch mit dem Tatbestand der Untreue, denn auch bei der Untreue eignet sich der Täter ein (fremdes) Gut zu. Im Unterschied zur Veruntreuung wurde dem Täter bei der Untreue das Gut jedoch nicht anvertraut, sondern ihm wurde die Vertretungsmacht über das Gut gegeben. Bei der Untreue ist der Täter daher berechtigt in fremdem Namen über ein fremdes Gut zu verfügen (zB Geschäftsführer, CFO, Prokurist, Vereinskassier).
Bei der Veruntreuung handelt der vermeintliche Täter im eigenen Namen (zB Notar, Rechtsanwalt, Treuhänder, Finanzdienstleister).
Veruntreuung im Unternehmen
Besteht der Verdacht, dass beispielsweise Gelder des Unternehmens veruntreut wurden, kann der Sachverhalt durch eine interne Untersuchung aufgearbeitet und geklärt werden. Ein Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft wird dadurch noch nicht eingeleitet, dazu muss sie, beispielsweise durch eine Anzeige Kenntnis vom Verdacht erlangen.
Klassische Vorfälle sind „Schwund“ in der Vereinskasse, Handkasse oder am Treuhandkonto oder bei Veranlagungen. Um welches Delikt es sich letztlich handelt, ist anhand der Handlung rechtlich zu prüfen. Es kann sich auch oftmals um einen Betrug handeln.
Wird Anzeige erstattet, können auch durch eine Zurückziehung dieser, die bereits eingeleiteten Ermittlungen nicht mehr gestoppt werden – bei sog. Offizialdelikten hat die Behörde von Amts wegen zu ermitteln. Ziel der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft ist es den Sachverhalt aufzuklären und die involvierten Personen auszuforschen. Dazu stehen ihr verschiedene Ermittlungsmaßnahmen zur Verfügung. Zur Sammlung von Beweisen bietet sich etwa eine Hausdurchsuchung im Unternehmen mit anschließender Sicherstellung und Beschlagnahme von Dokumenten und Daten an. Auch die Zeugenvernehmung von Personen durch das Landeskriminalamt, die Staatanwaltschaft oder Bundeskriminalamt ist eine mögliche Maßnahme.
Strafrahmen und Verjährung der Veruntreuung
Hat der Täter den Tatbestand der Veruntreuung verwirklicht, richtet sich der Strafrahmen am Wert des veruntreuten Gutes. Das Gesetz sieht hier folgende Abstufungen vor:
- bis € 5.000,
- über € 5.000 bis 300.000,
- mehr als € 300.000.
Hat das veruntreute Gut einen Wert bis € 5.000, droht dem Täter eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen. Wird ein Ersttäter zu einer Geldstrafe verurteilt, hängt die Höhe des Tagessatzes von seinem Einkommen ab. Die Anzahl der Tagessätze wird wie die Höhe der Freiheitsstrafe entsprechend der Tat vom Gericht festgelegt. Die Tat verjährt nach einem Jahr.
Hat das veruntreute Gut einen Wert über € 5.000 jedoch höchsten € 300.000, droht dem Täter eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Die Tat verjährt nach fünf Jahren. Übersteigt das veruntreute Gut einen Wert von € 300.000, droht dem Täter eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahre. Die Tat verjährt nach zehn Jahren.
Konsequenz einer Verurteilung ist auch ein Eintrag ins Strafregister.
Ist der Täter ein Mitarbeiter eines Unternehmens und hat dieser beispielsweise Gelder des Unternehmens veruntreut, kann gegen das Unternehmen auch eine Verbandsgeldbuße verhängt werden.
Tätige Reue: Voraussetzungen & Wirkung
Die Strafbarkeit kann durch Übung tätiger Reue aufgehoben werden. Der Täter muss dafür den ganzen durch seine Tat entstandenen Schaden gutmacht oder sich vertraglich zur Schadensgutmachung verpflichtet haben, bevor die Ermittlungsbehörde von seinem Verschulden erfahren hat. Unerheblich ist hierbei, ob er vom Opfer zur Schadensgutmachung gezwungen wurde. Der Täter kann auch eine Selbstanzeige bei der Behörde erstatten und den Schadensbetrag bei dieser erlegen.
Diversion möglich? – Voraussetzungen & Ablauf
Auch eine Diversion ist bis zu einem bestimmten Wert des veruntreuten Gutes unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Diese besteht für Taten, welche nicht mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind. Bei einer Veruntreuung kommt es auf die Höhe des Werts des veruntreuten Gutes an, da davon der Strafrahmen abhängt. Sie besteht in jenen Fällen, in welchen der Wert des veruntreuten Gutes € 300.000 nicht übersteigt, denn in diesem Fall ist eine (diversionsfähige) Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren angedroht. Übersteigt der Wert des veruntreuten Gutes einen Wert von € 300.000, ist die Tat mit Freiheitsstrafe bis zehn Jahren bedroht und eine Diversion grds nicht möglich.
Fazit
Gerade Unternehmen sehen sich oftmals mit dem Verdacht der Veruntreuung im Unternehmen konfrontiert. Um auch komplexe Sachverhalte bewältigen zu können, ist eine strukturierte Vorgehensweise wichtig. Die Erarbeitung einer individuell angepassten Strategie und die Setzung überlegter Schritte kann in einem möglichen Ermittlungsverfahren von großer Bedeutung sein. Ihr Anwaltsteam berät Sie zu Verhaltenstipps bei Einvernahmen (Rechte und Pflichten als Zeugen, Opfer und Beschuldigter).
Gerne beraten wir Sie und Ihr Unternehmen bei der Aufarbeitung von Verdachtsfällen und unterstützen Sie in einem Ermittlungs- und Strafverfahren.