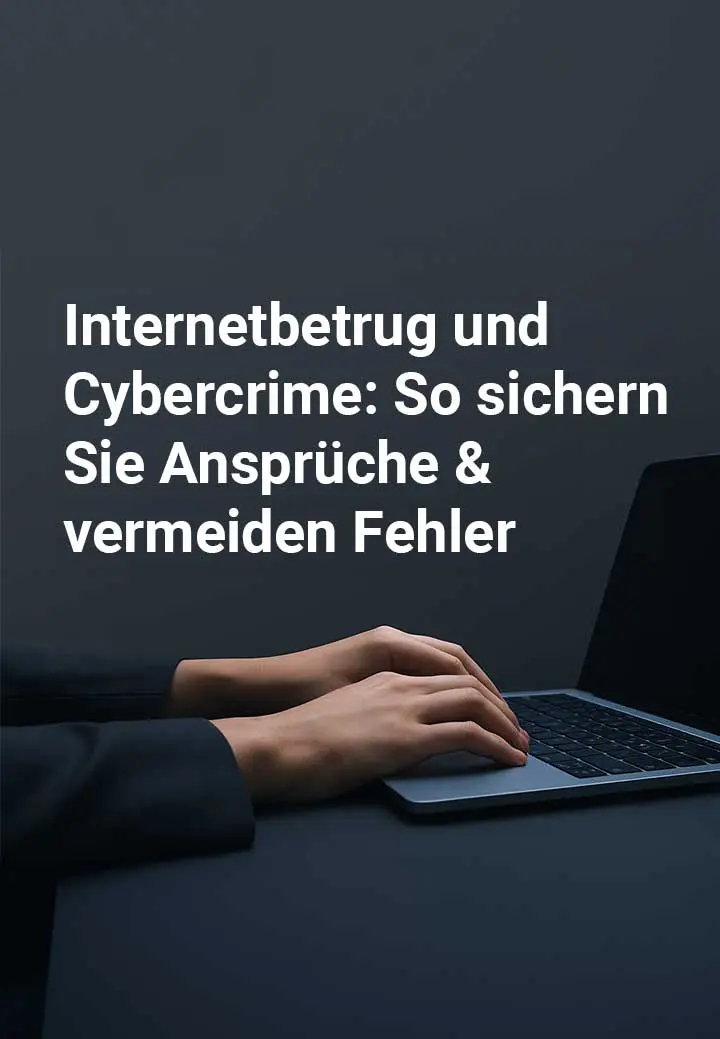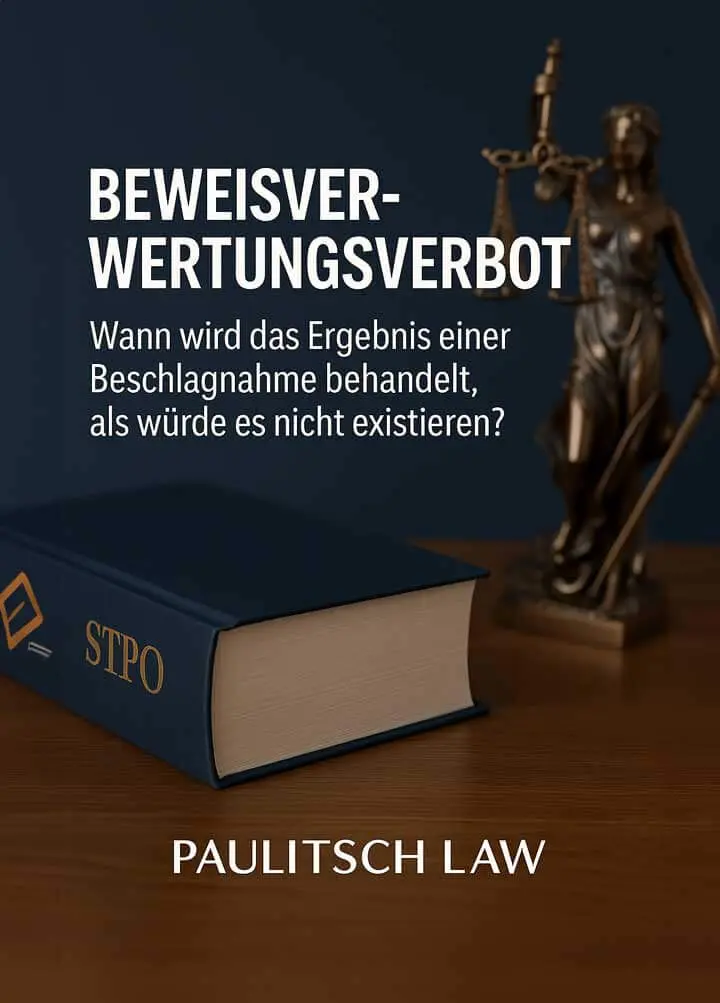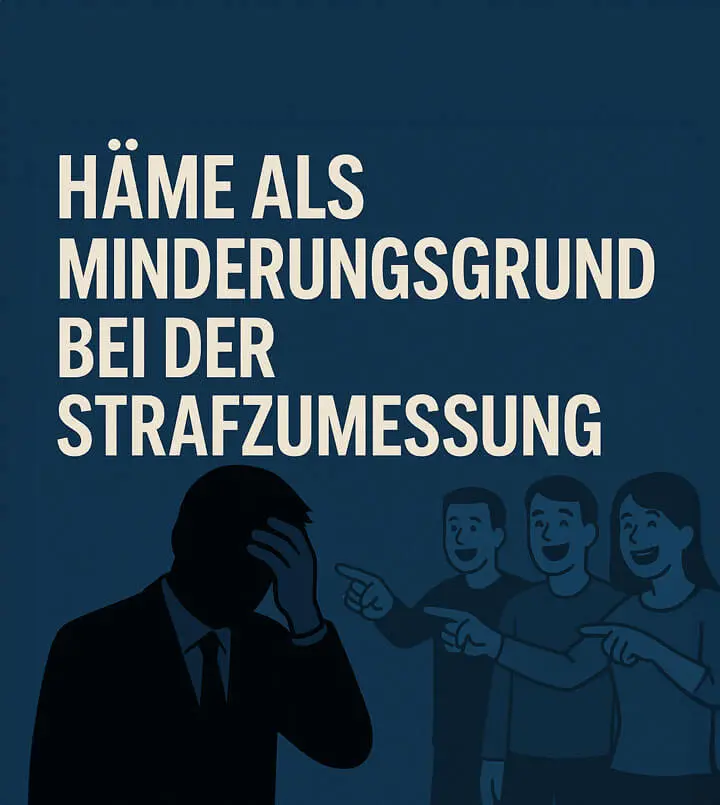Gesetzliche Neuerungen im Hinblick auf Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sind nicht nur aktuell, sondern immer wieder Thema. Dies ist auch notwendig, um wirtschaftlichen Entwicklungen wie der immer präsenter werdenden Cyberkriminalität hinterherzukommen. Da es sich um ein globales Problem handelt, sind gesetzliche Entwicklungen besonders stark durch internationale und europäische Vorgaben geprägt.
Am 1.9.2021 kam es in Folge der Umsetzung der EU-Geldwäsche-Richtlinie (EU 2018/1673, „EU-RL“) zu Neuerungen im Strafgesetzbuch, die wie folgt zusammengefasst werden können:
Neugestaltung des Tatbestandes der Geldwäscherei § 165 StGB
Wie bisher umfasst § 165 Abs 1 StGB sowohl Eigen- als auch Fremdgeldwäscherei. Die erste Fallgruppe (Z 1) umfasst das Umwandeln und die Übertragung von Vermögenswerten, die aus einer Vortat stammen und verlangt den erweiterten Vorsatz des Verheimlichens oder Verschleierns des illegalen Ursprungs bzw der Unterstützung einer beteiligten Person, dabei, den Rechtsfolgen ihrer Tat zu entgehen. Die zweite Fallgruppe (Z 2) macht das Verheimlichen oder Verschleiern der wahren Natur, Herkunft, Lage, Verfügung oder Bewegung solcher Vermögensbestandteile selbst zur Tathandlung, wobei bedingter Vorsatz genügt.
§ 165 Abs 2 StGB pönalisiert den Erwerb und Besitz sowie das an sich Bringen, Umwandeln, Übertragen oder sonstige Verwenden von Vermögenswerten, die aus Vortaten eines anderen herrühren, somit wie bisher ausschließlich Fremdgeldwäsche. Interessant ist die erfolgte Festschreibung des Vorsatzerfordernis der Wissentlichkeit hinsichtlich der Herkunft zum Zeitpunkt des Erlangens des Vermögenswertes. Durch diese zeitliche Klarstellung begründet das spätere Erlangen von Wissentlichkeit selbst dann keine Strafbarkeit mehr, wenn der Täter nach erlangen des Wissens seine Handlung fortsetzt.
§ 165 Abs 3 StGB regelt weiterhin Geldwäscherei hinsichtlich der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation oder terroristischen Vereinigung unterliegenden Vermögenswerten, wurde aber an die neue Terminologie und die neuen Tathandlungsalternativen des § 165 Abs 2 StGB angepasst.
Durch die Neugestaltung des § 165 StGB kam es zu Änderungen in der Terminologie (zB „verheimlichen“ statt bislang „verbergen„) und der Aufnahme neuer Begriffe. Letztere sollen den Gesetzesmaterialien zufolge zwar im Wesentlichen den bisherigen entsprechen, die Tathandlungsalternativen des § 165 Abs 2 scheinen jedoch weiter gefasst als nach der bisherigen Rechtslage.
Strafdrohung im Grunddelikt deutlich angehoben
Im Grundtatbestand kam es zu einer Verschärfung der Strafdrohung, die auf sechs Monate bis 5 Jahre Freiheitsstrafe angehoben wurde (die alte Fassung sah eine Strafdrohung von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe vor). Die Wertgrenze wie auch die Strafdrohung für qualifizierte Begehung bleiben unverändert. Wer die Tat in Bezug auf einen Vermögensbestandteil mit einem Wert über EUR 50.000 oder als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen (§ 165 Abs 4 StGB).
In Umsetzung der EU-RL wurde überdies ein neuer Erschwerungsgrund (§ 33 Abs 3 StGB) für „Verpflichtete“ iSd Geldwäsche-RL geschaffen. Dies betrifft Kredit- und Finanzinstitute, Notare, Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Immobilienmarkler oder Gewerbetreibende iZm mit risikogeneigten Geschäften, die in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit Täter einer Geldwäscherei werden.
„Kriminelle Tätigkeiten“ als Vortaten im In- und Ausland
Vortaten, die nun wie auch in der EU-RL als „kriminelle Tätigkeiten“ bezeichnet werden, sind in § 165 Abs 5 (statt bisher in Abs 1) aufgezählt. Der Vortatenkatalog an sich bleibt unverändert. Neu ist jedoch, dass eine gesetzliche Festschreibung der Anforderungen, die Taten zu geldwäschereitauglichen Vortaten machen, erfolgte. Kriminelle Handlungen müssen (zumindest) tatbestandsmäßig und rechtswidrig verübt worden sein. Dabei ist weder erforderlich, dass der Täter wegen der kriminellen Tat verurteilt werden kann, noch, dass alle Sachverhaltselemente oder alle Umstände iZm der Tat, wie zB die Identität des Täters, feststehen.
Zudem erfolgte eine Gleichstellung von im In- und Ausland begangenen Vortaten. Eine Straftat kann (unabhängig davon, wo sie begangen wurde) eine Vortat sein, wenn sie den österreichischen Strafgesetzen unterliegt. Aber auch eine Auslandstat, die nicht den österreichischen Strafgesetzen unterliegt, kann eine Vortat sein. Dies gilt jedenfalls, wenn die Tat sowohl im Inland als auch nach den Gesetzen des Tatortes den Tatbestand einer Straftat erfüllt. In Umsetzung der EU-RL wurden aber auch Ausnahmefälle vorgesehen, in denen ausschließlich auf die Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit nach österreichischem Recht abzustellen ist und damit selbst dann eine nach österreichischem Recht strafbare Vortat vorliegen kann, wenn die Handlung im Tatortland legal ist. Dies gilt für Taten, die unter den in Art 2 Z 1 der RL aufgezählten umfangreichen Straftatenkatalog subsumiert werden können (ua zB „Beteiligung an einer organisierten kriminellen Vereinigung und Erpressung„, „illegaler Handel mit gestohlenen und sonstigen Waren„, „Korruption„).
Legaldefinition von Vermögensbestandteilen
In § 165 Abs 6 StGB wurde eine Legaldefinition des zentralen Begriffes „Vermögensbestandteil“ aufgenommen. Wie schon bisher angenommen, ist der Begriff sehr weit gefasst. Er umfasst sowohl körperliche als auch unkörperliche, bewegliche wie unbewegliche, materielle und immaterielle Vermögenswerte sowie Urkunden, die Rechte an solchen belegen. Einheiten virtueller Währungen sowie auf diese entfallende Wertzuwächse (Kursgewinne) finden ausdrückliche Erwähnung. Andererseits ist, der bisher hM ebenso entsprechend, festgeschrieben, dass bloße Ersparnisse (zB Steuerersparnisse) kein Vermögensbestandteil sind.
Erweiterter Verfall
In § 20b Abs 2a StGB wurde eine neue Form des erweiterten Verfalls geschaffen. Diese soll es iZm Verfahren aus bestimmten Bereichen (schwere organisierte Kriminalität, Terrorismus oder Korruption) ermöglichen, aus mit Strafe bedrohten Handlungen stammende Vermögenswerte unabhängig vom Nachweis einer konkreten rechtswidrigen Tat für verfallen zu erklären, wenn das Gericht von der illegalen Herkunft überzeugt ist. Diese Überzeugung kann dabei insbesondere auf einen auffallenden Widerspruch zwischen dem Vermögenwert und den rechtmäßigen Einkünften des Betroffenen gestützt werden. Auch die Umstände des Auffindens des Vermögenswertes, die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen sowie die Ermittlungsergebnisse zu der Tat, die Anlass für das Verfahren war, können berücksichtigt werden.
Fazit
Es kam zu einer gründlichen Umgestaltung des Geldwäscherei-Tatbestandes, der inhaltlich aber durchaus noch an die alte Fassung erinnert. In mehrfacher Hinsicht kam es zu einer Verschärfung der Rechtslage (ua strengere Strafdrohung, Ausdehnung der Strafbarkeit von Auslandstaten und die Schaffung eines neuen Erschwerungsgrundes für Verpflichtete). Hingegen kam es durch die Neuregelung des Vorsatzerfordernisses bei Dauerdeliktsvarianten zu einer Straferleichterung. Durch die Definition von Vermögenswerten und die Festschreibung der Anforderungen an Vortaten konnten zumindest in mancher Hinsicht bislang bestehende Unsicherheiten entschärft werden. Im Sommer diesen Jahres hat die Europäische Kommission weitere umfassende Pläne zur unionsrechtlich gemeinsamen Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus bekannt gegeben. Neuerungen iZm Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden uns daher auch weiterhin begleiten.